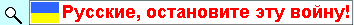| |
Untergattung: Bembidionetolitzkya Strand 1929 |
Carabidae - Trechinae - Bembidion |
|
|
Von Arved Lompe (n. G. Müller-Motzfeld) |
Informieren Sie mich bitte über Fehler oder Ergänzungen über mailbox@lompe.de |
|
|
Siehe auch Peryphus sensu Müller |
|
|
#1 |
Flügeldecken ± scharf in eine rotgelbe vordere und eine schwarze, bläulich-metallische hintere Hälfte getrennt. Die Naht vorn nicht dunkler. Aedoeagus: [Abb.1]. 4,3-5,2 mm. Mittel- und Südeuropa bis Kleinasien; montan. In Mitteleuropa im Alpen- und Voralpengebiet und den Sudeten, meist häufig an rasch fließenden Gewässern.  ...varicolor F., 1803 ...varicolor F., 1803
(=tricolor (F.) 1801, nec Gmel.) |
|
|
-- |
Flügeldecken einfarbig, oder die braunrote Färbung reicht unscharf begrenzt über die Mitte nach hinten. Naht stets dunkel ...2 |
|
|
#2 |
Halsschildbasis fast gerade, seitlich nur schwach abgeschrägt [Abb.2] oder etwas ausgebuchtet, die Hinterecken manchmal ± nach außen gezogen, die Hinterwinkel deshalb rechtwinklig bis schwach stumpfwinklig. ...3 |
|
|
-- |
Halsschildbasis seitlich stärker abgeschrägt, so daß der Seitenrand mit der Basis im deutlich stumpfem Winkel zusammentrifft [Abb.3]. ...6 |
|
|
#3 |
Schläfen von halber Augenlänge, gehen in flachem Bogen in den Hals über. Beine und Fühler lang. Die Fühler reichen bis über die Flügeldeckenmitte, ihr 3. und 4. Glied fast gleich lang, das 2. nur halb so lang wie das 3.. Flügeldecken sehr fein genetzt (100x), die Maschen etwa doppelt so breit wie lang. 6-7,5 mm. Montane Art der Alpen, Karawanken und Pyrenäen. Subalpin im Schotter von Gebirgsbächen, nur stellenweise und selten.  ...longipes Daniel, 1902 ...longipes Daniel, 1902
|
|
|
-- |
Schläfen viel kürzer, gegen den Hals mehr abgesetzt. Beine und Fühler kürzer. Die Fühler reichen kaum bis zur Flügeldeckenmitte, ihr 4. Glied kürzer als das 3., das 2. Glied meist über halb so lang wie das 3.. ...4 |
|
|
#4 |
Die Maschen der Flügeldeckenetzung unregelmäßig, kaum breiter als lang, bei 50x sichtbar [Abb.4]. Schläfen länger und gegen den Hals nicht deutlich abgesetzt (von oben gesehen). Halsschild stark quer. Aedoeagus [Abb.5] [Abb.6]. 5,2-6,5 mm. Montane bis alpine Art der Pyrenäen, des Französischen Zentralplateaus und der Alpen (bis nach Kroatien), sehr lokal, aber stellenweise häufig, an Gebirgsbächen.  ...complanatum Heer, 1837 ...complanatum Heer, 1837
|
|
|
-- |
Die Maschen der Flügeldeckenetzung quer, gestreckt, mindestens doppelt so breit wie lang. Schläfen gegen den Hals scharf abgesetzt. Halsschild weniger stark quer. ...5 |
|
|
#5 |
Größer, 5,5-6,5 mm [Abb.7]. Flügeldeckennetzung eng quermaschig [Abb.8], die Maschen über 3 x so breit wie lang. Flügeldeckenreihen am Diskus nicht vertieft, am Absturz meist nichts mehr von einer Punktierung der Reihen erkennbar. Flügeldecken am Ende mehr gemeinsam kurz abgerundet [Abb.9]. In der Regel nicht metallisch. Aedoeagus [Abb.10] [Abb.11]. In Europa weit verbreitet, nördlich bis Schottland und Südwestnorwegen; in Deutschland bis zum Harz, aber nicht in der Nordeutschen Tiefebene. Auch in Südeuropa und Kleinasien an schattigen Gebirgsbächen mit schotterigen Ufern. Geht hoch ins Gebirge, meist häufig.   ...tibiale (Duft., 1812) ...tibiale (Duft., 1812)
|
|
|
-- |
Kleiner, 4,5-6 mm [Abb.12]. Etwas glänzender, deutlich metallisch. Flügeldeckennetzung feiner, weitmaschiger, die Maschen weniger gestreckt, etwa doppelt so breit wie lang [Abb.13] [Abb.14]. Aedoeagus [Abb.15]. Flügeldeckenstreifen meist auch an derSpitze erkennbar punktiert und am Diskus etwas vertieft. Flügeldecken am Ende mehr einzeln zugespitzt [Abb.16]. Verbreitung ähnlich wie tibiale, in Deutschland bis zum Harz, stellenweise häufig an schattigen Gebirgsbächen.   ...geniculatum Heer, 1837 ...geniculatum Heer, 1837
|
|
|
#6 |
Flügeldecken am Ende kurz verengt und breit abgerundet ...7 |
|
|
-- |
Flügeldecken am Ende länger verengt und spitzer ...8 |
|
|
#7 |
Vordere 2/3 der Flügeldecken ± rotbraun aufgehellt, zur Spitze dunkel metallisch. Kopf und Halsschild stärker blaugrün metallisch. Halsschildmitte schwächer chagriniert, fast glatt. Aedoeagus: [Abb.17] [Abb.18]. Größer, 4,5-6 mm. Die Borstenpunkte am Kopfschildvorderrand groß, rund und glatt, vom Seitenrand etwa gleich weit entfernt wie vom Vorderrand Montan in den Ostpyrenäen, Nördl. Kalkalpen, Sudeten bis zum Balkan und den nördl. Gebirgen Kleinasiens. Bei uns meist häufig an grobschotterigen Ufern von Gebirgsbächen.  ...conforme (Dej., 1831) ...conforme (Dej., 1831)
|
|
|
-- |
Flügeldecken einfarbig schwarz metallisch, Kopf und Halsschild weniger glänzend metallisch. Halsschild gleichmäßig chagriniert. Aedoeagus: [Abb.19]. Kleiner, 4-5 mm. Die Borstenpunkte am Kopfschildvorderrand kleiner, weniger glatt, liegen näher am Seiten- als am Vorderrand. West- und Mitteleuropa, meist montan. In Mitteleuropa im Westen häufig, nach Osten seltener. In der Tschechoslowakei selten, fehlt in Österreich.   ...atrocaeruleum (Steph., 1828) ...atrocaeruleum (Steph., 1828)
|
|
|
#8 |
Halsschildseitenrand fein mit schmaler Kehle, der mittlere Borstenpunkt berührt höchstens den inneren Rand der Seitenrandkehle ...9 |
|
|
-- |
Halsschildseitenrand kräftiger mit breiter Kehle, der mittlere Borstenpunkt liegt vollständig innerhalb der Seitenrandkehle ...10 |
|
|
#9 |
Kopf und Halsschild hochglänzend metallisch blaugrün. Etwas kleiner, 5,5-6,5 mm. Flügeldecken zwischen Naht und Außenrand in ganzer Länge ± braun durchscheinend. Mikroskulptur der Flügeldecken quermaschig [Abb.20]. Aedoeagus [Abb.21] [Abb.22]. Montane Art, in den Pyrenäen und Mitteleuropa (Alpen und süddeutsche Mittelgebirge). Stenotop an Schotterufern der Gebirgsflüsse.  ...fasciolatum (Duft., 1812) ...fasciolatum (Duft., 1812)
|
|
|
-- |
Kopf und Halsschild mäßig glänzend metallisch blaugrün. Etwas größer, 5,5-7 mm. Flügeldecken matur einfarbig schwarz, ± grünblau metallisch. Montane Art in Südeuropa, von Spanien bis zu den Südostalpen. In Mitteleuropa nur in Kärnten.  ...bugnioni Dan. ...bugnioni Dan.
|
|
|
#10 |
Oberseite einfarbig schwarz mit ziemlich starkem blauem Metallglanz. ...11 |
|
|
-- |
Flügeldecken selten einfarbig, scheinen meist ± braun durch, haben aber wie Kopf und Halsschild nur schwachen Metallglanz ...12 |
|
|
#11 |
Halsschildbasis nur gerunzelt, unpunktiert. 5,2-7 mm. Südwesteuropa, östl. bis Südtirol; westl. Nordafrika. Nach Horion trotz alter Meldungen nicht in Mitteleuropa. Die meisten Meldungen beziehen sich auf bläuliche Exemplare von ascendens. coeruleum ssp. ...astrabadense Mannerheim 1844
(=transcaucasicum Lutsh. 1937)
(=concoenuleum Net. 1943) |
|
|
-- |
Halsschildbasis mit seichten Punktgrübchen. 5,2-7 mm. Südosteuropa, Kleinasien, Kaukasus, Banat, Siebenbürgen, vielleicht in der Slowakei. ...concoeruleum Netol., 1943
|
|
|
#12 |
Kleiner, um 6 mm. Flügeldecken meist deutlicher aufgehellt. Halsschildseitenrandkehle schmaler, an der Vorderecke nicht einwärts gekrümmt. Die vom Innenrand der Augen zur Fühlerwurzeln laufenden feinen Furchen wenig scharf und bereits von den Augen ab konvergent. Siehe fasciolatum LZ >>>9
|
|
|
-- |
Größer, 6,5-7,8 mm. Flügeldecken höchstens schwach aufgehellt. Halsschildseitenrandkehle breiter, an der Vorderecke einwärts gekrümmt. Die vom Innenrand der Augen zur Fühlerwurzel laufenden feinen Furchen scharf und anfangs nahezu parallel. ...13 |
|
|
#13 |
Etwas größere und breitere Art, Größe: 6-8,1 mm. Sehr variabel in der Färbung, olivgün bis dunkelbraun/schwarz mit schwachem Metallschimmer, oft ähnlich wie fasciolatum von den Schultern ab nach hinten mit hellerem Längsfleck, der nach hinten undeutlicher wird: forma bokoriCsrKI, 1928 (= axillare K. Daniel, 1902 nec Motschulsky, 1844) oder ganz schwarz mit blaugrünem Metallschimmer, dieser nie so deutlich wie bei coeruleum und auch ohne Aufhellung an der Flügeldeckenspitze. Punktstreifen nach hinten stärker eingedrückt als bei diesem und Flügeldecken mit stärker gewölbten Zwischenräumen: forma egregium K. Daniel, 1902. Im Vergleich zu der folgenden Art sind die Unterschiede im Feinbau des Penis [Abb.23] folgende: Das „Flagellum" ist ± gerade im Gegensatz zu fasciolatum und pseudascendens, insgesamt ist das Genital größer und die weiter vorn liegenden zentralen Armaturen sind kompakter. Verbreitung aufgrund von Verwechslungen nur ungenau bekannt: Von Frankreich über das südliche Mitteleuropa, Norditalien, Balkan bis Anatolien. Montan bis hochmontan, Schotterufer von Fließgewässern.   ...ascendens Dan., 1902 ...ascendens Dan., 1902
|
|
|
-- |
Etwas kleiner, in der Größe zwischen fasciolatum und ascendens stehend, Halschild deutlich schmaler und etwas kleiner als ascendens, nicht so schlank und nicht so stark nach hinten verengt wie bei fasciolatum, nur nach dem Genital der Männchen sicher zu bestimmen, Penis: [Abb.24]. Von ascendens durch die andere Anordnung der zentralen Armaturen und das stärker gekrümmte Flagellum, von fasciolatum durch bedeutendere Größe und die starke Körnelung des membranösen Sacks zu unterscheiden (Manderbach & Müller-Motzfeld 2004). Auch ökologisch von beiden Arten verschieden; hochmontan bis subalpin, oft zusammen mit complanatum an Schotterufern reißender Gebirgsbäche. Vom nördlichen Alpenrand Deutschlands bis zu den Ostalpen nachgewiesen, genaue Verbreitung noch unbekannt.  ...pseudascendens Manderbach & Müller-Motzfeld, 2004 ...pseudascendens Manderbach & Müller-Motzfeld, 2004
|
|
|
|
ascendens
astrabadense
atrocaeruleum
bugnioni
complanatum
concoeruleum
conforme
|
fasciolatum
geniculatum
longipes
pseudascendens
tibiale
varicolor
|
|
|

Erstellt am: 05.08.2009
Letzte Aktualisierung: 14.12.2020 - 17:11:43
Version: 3.6.1 von: Arved Lompe
Vorherige Version |
|