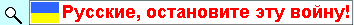|
Gattung Agrilus Curtis, 1825 |
Coleoptera - Polyphaga - Tarsen-5-5-5 - Buprestidae |
|
|
Von Arved Lompe
Informieren Sie mich bitte über Fehler oder Ergänzungen über mailbox@lompe.de |
Literaturverzeichnis => |
|
|
Halsschild mit doppelter Seitenrandkante, neben den Hinterwinkeln meist mit einem Kiel. Die Augen berühren fast den Halsschildvorderrand. Klauenbasis mit 1 Zahn; dieser ist bei den ♀ kurz und breit mit relativ stumpfer Spitze, bei den ♂ der meisten Arten zum Teil lang und dünn, so daß die Klauen gespalten erscheinen. Infolge der zum Teil sehr diffizilen Unterschiede zwischen den einzelnen Arten einerseits und der großen Variabilität innerhalb der Arten andererseits, ist vor allem die Bestimmung der ♀ oft nicht einfach; faunistische Angaben sollten daher besonders bei kritischen Arten durch Funde von ♂ belegt sein! Da im Bestimmungsgang auf einige wichtige Merkmale der Unterseite nicht verzichtet werden kann, empfiehlt es sich, die Tiere entsprechend zu präparieren; meist genügt es, mit dem Leim beim Aufkleben etwas sparsam zu sein, da die in Frage kommenden Merkmale mit einiger Übung bei sauber geklebten Tieren auch von der Seite gut sichtbar sind. Die Larven entwickeln sich ausschließlich in Laubgewächsen. Die Imagines findet man oft gesellig auf ihren Entwicklungspflanzen oder der benachbarten Vegetation. Die Gattung ist > 3300 Arten über die ganze Welt verbreitet. In Europa sind 78 und in unserem Gebiet ca. 40 Arten vertreten. In der Tabelle werden vorerst nur die mitteleuropäischen Arten behandelt sowie 3 potentiell gefährliche und daher unter EU-Quarantäne gestellte Arten. |
|
|
#1 |
Pygidium mit einem Mittelkiel der in einem +/- langen Fortsatz endet [Abb.1] [Abb.2]. ...2
|
|
|
-- |
Pygidium einfach gerundet. ...6
|
|
|
#2 |
Jede Flügeldecke mit 3 hellen Haarflecken: Der 1. an der Basis innen neben der Schulterbeule, der 2. kurz vor, der 3. hinter der Mitte neben der Naht [Abb.3] [Abb.4] [Abb.5]. Dunkel, fast schwarz, mit schwachem Metallschein. ...3
|
|
|
-- |
Flügeldecken ohne solche Haarflecken. Hierher 2 exotische Arten die, wenn eingeschleppt, im Verdacht stehen, erhebliche Schäden verursachen zu können. ...5
|
|
|
#3 |
Flügeldeckenenden in lange divergierende Spitzen ausgezogen [Abb.3]. Halsschild ohne Haarbinde am Seitenrand. Hinterhüften, Sternite 2-5 und Pleurite 1 und 3-5 mit hellen Haarflecken. Schwarz mit blauem oder grünem Schein. 8,5-12 mm.
♂: Klauentyp A [Abb.6]. Aedoeagus [Abb.7].
B: Entwicklung in Weiden (Salix caprea, aurita).
D: Im Südwesten und Südosten des Gebietes, verstreut und selten; ein isoliertes Vorkommen auch am Südrand der Lüneburger Heide.     ...guerini Lacord., 1835 ...guerini Lacord., 1835
|
|
|
-- |
Flügeldeckenenden abgerundet oder zwischen der Zähnung mit einer größeren, gerade nach hinten gerichteten, dornartigen Spitze [Abb.1]. Halsschild am Seitenrand mit einer hellen Haarbinde [Abb.4]. ...4
|
|
|
#4 |
Die helle Behaarung ist weiß. Flügeldeckenenden zwischen der Zähnung mit einer größeren, gerade nach hinten gerichteten, dornartigen Spitze [Abb.4] [Abb.1]. Halsschild mit einem hell behaarten Band neben dem Seitenrand, Abdomen wie bei dem vorigen behaart. Schwarz mit olivgrünem bis bronzefarbenem Schimmer. 6,5-11 mm.
♂: Klauentyp A [Abb.6]. Aedoeagus [Abb.8].
B: Entwicklung in Weiden und Pappeln. VI-VII.
D: Europa, nicht im Nordwesten; selten.     ...ater (L., 1767) ...ater (L., 1767)
|
|
|
-- |
Die helle Behaarung ist gelbweiß bis goldgelb [Abb.5] [Abb.9]. Flügeldeckenenden nur fein gezähnelt. Schwarz mit dunklem Bronzeschimmer. ♂ mit einem Eindruck auf dem 1. Ventralsegment. 9-11 mm.
B: Entwicklung in Eichenarten. Verursacht große Schäden im Westen der USA.
D: Heimat: Südstaaten USA, Mexiko  ...auroguttatus Schaeffer, 1905 ...auroguttatus Schaeffer, 1905
Falls der Verdacht besteht, daß diese Art in Europa gefangen wurde, sollte sie sofort einem Fachmann zur Überprüfung vorgelegt werden. Siehe auch EFSA - Pest Survey Card efsa.onlinelibrary.wiley.com
|
|
|
#5 |
Einfarbig smaragdgrün bis blaugrün[Abb.10] [Abb.11] mit grün-goldener Unterseite oder Halsschild dunkel schwarzgrün bis bronzefarben, Tergite auffallend kupferrot bis purpurn [Abb.2]. Bei ♀ kommen auch oberseits violette, blaue, kupfrige und rotgoldene Farbvarianten vor. Hinterwinkel des Halschschilds ohne Kiel. Kinnfortsatz groß, nicht ausgeschnitten. Aedoeagus [Abb.12]. 7,5-15 mm. Asiatischer Eschenprachtkäfer.
B: Entwicklung in Eschenarten (Fraxinus). Hat in Nordamerika nach der Einschleppung große Schäden an den Eschenbeständen verursacht.
D: Heimat: Ostasien. Eingeschleppt nach Nordamerika und Westrußland. Nach Westen bis zur Ukraine ausgebreitet.    ...planipennis Fairmaire, 1888 ...planipennis Fairmaire, 1888
Falls der Verdacht besteht, daß diese Art in Europa gefangen wurde, sollte sie sofort einem Fachmann zur Überprüfung vorgelegt werden. Siehe auch EFSA Pest Survey Card efsa.onlinelibrary.wiley.com
|
|
|
-- |
Dunkel schwarz-bronzefarben bis oliv-bronzefarben mit rotem, grünem oder pupurnem Schimmer [Abb.13]. Stirn des ♂ grünlich, des ♀ kupfrig. Pygidium dunkel, gekielt und mit einem Fortsatz. Hinterwinkel des Halsschilds gekielt. Aedoeagus [Abb.14]. 5,5-13 mm. Bronzener Birkenprachtkäfer.
B: Entwicklung in Birke. Sehr schädlich in Nordamerika.
D: Heimat: USA, Kanada.  ...anxius Gory, 1841 ...anxius Gory, 1841
Falls der Verdacht besteht, daß diese Art in Europa gefangen wurde, sollte sie sofort einem Fachmann zur Überprüfung vorgelegt werden. Siehe auch EFSA Pest Survey Card efsa.onlinelibrary.wiley.com
|
|
|
#6 |
Jede Flügeldecke mit 1 weißen Haarflecken hinter der Mitte neben der Naht [Abb.15], manchmal ein weiterer, weniger deutlicher an der Basis innen neben der Schulterbeule. Flügeldeckenspitze verrundet, der Rand gezähnt aber ohne Dorn. Spitze des Pygidiums abgerundet. Außenseiten der Hinterhüften, Sternite 3-5 und Pleurite 1, 3, 4 - manchmal auch 5 - mit hellen Haarflecken. Goldgrün, grün, blau; ♂ einfarbig, beim ♀ Kopf und Halsschild goldgrün. 8-13 mm.
♂: Klauentyp A [Abb.6].
B: Entwicklung in dicker Rinde verschiedener Eichenarten. V-VII.
D: Europa, nach Norden seltener, im Gebirge bis ca. 1000 m.     ...biguttatus (F., 1776) ...biguttatus (F., 1776)
|
|
|
-- |
Flügeldecken ohne derartige Flecken, einheitlich hell oder dunkel behaart oder mit größeren, weniger dicht und hell behaarten Bereichen [Abb.16]. ...7
|
|
|
#7 |
Prosternalfortsatz rautenförmig oder trapezförmig [Abb.17]. Randfurche des letzten Sternits an der Spitze nach innen gebogen, davor ± tief gefurcht [Abb.18]. ...8
|
|
|
-- |
Prosternalfortsatz zwischen den Vorderhüften ± parallel [Abb.19]; bei graminis sind die Seiten zwar aufgebogen, aber die Kontur ist parallel. Randfurche des letzten Sternits wie oben oder einfach gerundet [Abb.20]. ...15
|
|
|
#8 |
Flügeldecken unauffällig dunkel behaart, bei flüchtiger Betrachtung kahl erscheinend: Haare einfach, im Querschnitt ± drehrund; gleichmäßig über die Flügeldecken verteilt. ...9
|
|
|
-- |
Flügeldecken deutlich mit hellen Haaren besetzt, die etwas schuppenförmig abgeflacht erscheinen (× 100). Entweder sind sie gleichmäßig über die Flügeldecken verteilt oder es ist zumindest im Spitzendrittel der Flügeldecken ein ± breiter Längsflecken neben der Naht auffallend silberweiß behaart (meistens schon mit bloßem Auge sichtbar). ...11
|
|
|
#9 |
Halsschild in der Mitte querüber gewölbt, ohne flache Längsfurche. Hinterbrustfortsatz vorne zwischen den Mittelhüften ausgehöhlt (hinter der Aushöhlung für den Prosternalfortsatz) [Abb.21]. Bronzegrün, Halsschild etwas golden-kupfrig [Abb.22]. 3,5-5,5 mm.
♂: Klauentyp C [Abb.23]. Aedoeagus [Abb.24] [Abb.25].
B: Entwicklung in Eschen, Liguster, Flieder. VI-VIII.
D: Bei uns weit verbreitet, aber selten; im Nordwesten erst seit neuerer Zeit.     ...convexicollis Redt., 1849 ...convexicollis Redt., 1849
|
|
|
-- |
Halsschild mit einer flachen Längsfurche, die mitunter nur bei einem bestimmten Lichteinfall sichtbar ist. Hinterbrustfortsatz zwischen den Mittelhüften flach. ...10
|
|
|
#10 |
Durchschnittlich größere Art: 4-6,5 mm. Stirn zwischen den Augen ziemlich flach. Blaugrün, bronzegrün [Abb.26].
♂: Fühler stark blattartig erweitert [Abb.27] und die einzelnen Glieder auf der Rückseite ausgehöhlt. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus asymmetrisch seitwärts gebogen [Abb.29].
♀: Fühler relativ kurz und gedrungen, 4. Glied fast so breit wie lang.
B: Entwicklung in verschiedenen Eichenarten, Hasel, Edelkastanie, eventuell Buche. VI-VIII.
D: Im ganzen Gebiet, stellenweise selten.     ...laticornis (Ill., 1803) ...laticornis (Ill., 1803)
(=scaberrimus Ratzeb.)
(=asperrimus Mars.)
|
|
|
-- |
Kleiner, 3,5-4,5 mm. Stirn zwischen den Augen gewölbt. Färbung dunkler bronzefarben. Bildung des Prosternalfortsatzes nicht einheitlich: parallel oder etwas rautenförmig .
♂: Fühler nicht auffallend verbreitert.
♀: Das 4. Fühlerglied deutlich länger als breit.
Vergleiche obscuricollis LZ >>>21
(=asperrimus auct.?)
|
|
|
#11 |
Helle Behaarung der Flügeldecken nicht durch ein dunkles Querband hinter der Mitte unterbrochen, aber mitunter nur neben der Naht vorhanden. Die Haare weißlich oder gelblich. ...12
|
|
|
-- |
Helle Flügeldeckenbehaarung entweder hinter der Mitte breit unterbrochen [Abb.30] oder auf ein Längsband im letzten Drittel neben der Naht beschränkt. ...14
|
|
|
#12 |
Fühlerglieder 5-8 mit etwas verrundeten Außenecken [Abb.31], etwa so lang wie breit. Kleinere, gestrecktere Art. Halsschild mit flacher Mittellängsfurche. Olivgrün, bronzegrün [Abb.32]. Kopf und Halsschild des ♀ etwas rötlicher. 4-4,5 mm.
♂: 2. Sternit vor der Mitte des Hinterrand mit 2 Körnchen. Vorderbrust in der Mitte und Hinterhüften über der Schenkeleinlenkung mit einem kegelförmigen Haarbüschel. 5. Sternit tief gefurcht. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus stark asymmetrisch [Abb.33] [Abb.34].
♀: Innenrand der Augen gerade [Abb.35].
B: Larve in Hainbuche und Haselnuß, vielleicht auch in Eiche. V-IX.
D: Im ganzen Gebiet nicht häufig, nach Nordwesten selten oder sehr selten.     ...olivicolor Kiesw., 1857 ...olivicolor Kiesw., 1857
(=sexualis Ab.?)
|
|
|
-- |
Fühlerglieder 5-8 mit spitzen Außenecken [Abb.36], eher länger als breit. ♂: 2. Sternit vor der Mitte des Hinterrandes ohne diese Kornchen. 5. Sternit nur in der apikalen Halfte flach eingedruckt. Aedeagus schlank, symmetrisch. ...13
|
|
|
#13 |
♂ sehr klein (2,9-3,1 mm), schlank, stark glänzend pechschwarz [Abb.37], die Stirn mit angedeutet bläulichem Bleiglanz [Abb.38]. Das Kielchen in den Hinterecken des Halsschilds ist nach vorn gerichtet.
♂: Klauentyp E [Abb.39]. Der Aedeagus ist langgestreckt, im Mittelteil konvex mit schmaler Langsrinne [Abb.40].
D: Aus Bulgarien beschrieben.     ...ziegleri Niehuis, 2006 ...ziegleri Niehuis, 2006
|
|
|
-- |
Deutlich größere Art (4,5-6 mm), gedrungen, seidenschimmernd olivgrün, die Stirn des ♂ bläulich. Das Kielchen in den Hinterecken ist lang, nach außen gebogen, es läßt sich undeutlich bis zum Seitenrand verfolgen. Halsschild tiefer gefurcht als bei olivicolor; Stirn fast ungefurcht.
♂: Klauentyp E [Abb.39]. Der Aedeagus ist breit, oberseits im Mittelteil querüber ausgehöhlt, nur die Ränder der Parameren ragen noch scharfkantig empor [Abb.41] [Abb.42].
♀: Innenrand der Augen nach vorne leicht verengt; Kopf und Halsschild wie die Flügeldecken gefärbt.
B: Entwicklung in dünnen Eichenästen. VII-IX.
D: Verbreitung ungeklärt; Süd- und Westeuropa; im Südwesten des Gebietes vielleicht aufzufinden. Die alten Angaben sind wegen Verwechslung mit litura unzuverlässig.    ...curtulus Muls.Rey, 1863 ...curtulus Muls.Rey, 1863
|
|
|
#14 |
Schlanker, Flügeldecken über den Schultern gemessen mehr als 3x so lang wie breit. Innere Flügeldeckenhälfte hell behaart, die Behaarung hinter der Mitte durch ein dunkles Querband unterbrochen [Abb.30]. Olivgrün bis bronzegrün, selten dunkelblau oder schwarz. 4,5-5 mm.
♂: 2. Sternit ohne Körnchen, Hinterhüften mit Haarbüscheln; 5. Sternit sehr flach der Länge nach eingedrückt. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.43].
♀: Fühler gestreckter und schärfer gesägt als bei olivicolor: Stirn deutlich gefurcht, Innenrand der Augen konkav [Abb.44].
B: Larven in abgestorbenen Rebenästen. V-VIII.
D: Überall in Europa wo die Weinrebe gedeiht, in Mitteleuropa meist selten, in Südeuropa sehr häufig.     ...derasofasciatus Lacord., 1835 ...derasofasciatus Lacord., 1835
|
|
|
-- |
Gedrungener, Flügeldecken weniger als 3x so lang wie breit [Abb.45]. Flügeldecken ähnlich behaart oder meist nur im Spitzendrittel mit einem hellen Längsstreif, der mitunter nur bei bestimmtem Lichteinfall zu sehen ist [Abb.46]. Halsschild mit 2 ziemlich tiefen hintereinanderliegenden Längseindrücken in der Halsschildmitte; Stirn hinten deutlich gefurcht. Dunkel olivgrün, bronzegrün. 4,5-6,5 mm.
♂: 2. Sternit einfach oder mit 2 ganz flachen Unebenheiten. Hinterhüften ohne Haarbüschel. 5. Sternit mit sehr flacher Längsvertiefung. Klauentyp E [Abb.39]. Basis des Paramerenteils etwas schmäler und zierlicher als bei curtulus Aedoeagus [Abb.47] [Abb.48].
♀: Innenrand der Augen schwach konkav.
B: Entwicklung wahrscheinlich in Eiche.
D: Südosteuropa, südöstliches Mitteleuropa; sehr selten.     ...litura Kiesw. ...litura Kiesw.
|
|
|
#15 |
Randfurche des 5. Sternits deutlich ausgerandet, davor oft ± tief gefurcht [Abb.18]. ...16
|
|
|
-- |
Randfurche des 5. Sternits einfach [Abb.20]. ...22
|
|
|
#16 |
Flügeldecken neben der Naht zumindest hinter der Mitte mit einem großen Flecken heller Haare [Abb.16], meist mit einem hellen Längsband, das hinter der Mitte durch ein dunkles Querband unterbrochen ist. ...17
|
|
|
-- |
Flügeldecken einförmig und unauffällig dunkel behaart, kahl erscheinend, manchmal ein feiner hell behaarter Längsstrich vor der Flügeldeckenspitze. ...18
|
|
|
#17 |
Halsschildvorderrand in der Mitte nach vorne das Niveau der Vorderwinkel überragend [Abb.49]. Prosternalfortsatz zur Spitze plötzlich verengt, die Seiten aufgebogen [Abb.19]. Schlanker als hastulifer. Dunkel olivgrün [Abb.50], aber heller als hastulifer. 4,5-7 mm.
♂: Fühler vom 6.-10. Glied nach außen stark, nach innen schwächer erweitert [Abb.51] [Abb.52]. 2. Sternit einfach; Vorderbrust in der Mitte lang bürstenartig behaart, Hinterhüften mit je einem kleinen Haarbüschel über der Schenkeleinlenkung. Klauentyp E [Abb.39]. Aedoeagus [Abb.53] [Abb.54].
♀: 2. Fühlerglied etwa 2 × so lang wie breit. Analsternit schwach gefurcht.
B: Larve in Eiche, eventuell auch in Buche und Erle. VI-VIII.
D: Im Süden und Osten, stellenweise und selten.     ...graminis Kiesenwetter, 1857 ...graminis Kiesenwetter, 1857
(=disparicornis Bedel)
|
|
|
-- |
Mittellappen des Halsschildsvorderrand das Niveau der Vorderwinkel nicht überragend [Abb.55]. Prosternalfortsatz wie Typ c in [Abb.19]. Dunkel bronzegrün, Flügeldecken hinter der Mitte schwärzlich [Abb.16]. Stirn beim ♀ bronzegrün, beim ♂ heller grün. 5-7 mm.
♂: Fühlerglieder nach innen nicht erweitert [Abb.56]. Vorderbrust dicht behaart, Hinterhüften ohne Haarbüschel. 2. Sternit am Hinterrand mit 2 Höckerchen. Klauentyp E [Abb.39]. Aedoeagus schwach asymmetrisch [Abb.57] [Abb.58].
♀: Etwas gedrungener als die vorige Art, 2. Fühlerglied kürzer. Analsternit ungefurcht. Halsschildvorderrand in der Mitte flacher.
B: Larve in Eichen.
D: Südeuropa, südliches Mitteleuropa; aus dem Gebiet nur alte Funde, sehr selten.     ...hastulifer (Ratz., 1837) ...hastulifer (Ratz., 1837)
|
|
|
#18 |
Schildchen ohne oder nur mit undeutlichem Querkiel [Abb.59]. Zweifarbig: Vorderkörper grün oder blau, Flügeldecken golden bis kupfrig [Abb.60]. 7-10 mm
♂: Klauentyp C [Abb.23]. Aedoeagus [Abb.61]..
B: Larve in verschiedenen Weidenarten, nicht in Zitterpappel oder Hasel (Hellrigl, l. c.). VI-VIII.
D: Nord- und Mitteleuropa, stellenweise und selten, nach Nordwesten fehlend.    ...subauratus (Gebl., 1833) ...subauratus (Gebl., 1833)
|
|
|
-- |
Schildchen mit deutlichem Querkiel; einfarbige Arten; höchstens ein geringer Farbunterschied zwischen Halsschild und Flügeldecken. ...19
|
|
|
#19 |
Stirn mit tiefer Längsfurche; Halsschild auf der Oberseite ohne Kiele in den Hinterwinkeln. Oberseite schön blau [Abb.62], seltener grün, Unterseite meist schwarz, sonst wie die Oberseite. Kinnfortsatz besonders beim ♂ stark ausgeschnitten [Abb.63] [Abb.64], selten nur schwach ausgerandet. 4,5-7 mm.
♂: Hinterhüften mit einem Höckerchen. Klauentyp C [Abb.23]. Aedoeagus [Abb.65] [Abb.66].
B: Galt früher als polyphag, nach Hellrigl jedoch sicher bisher nur in Lonicera- und Rhamnus-Arten nachgewiesen. VI-VIII.
D: Im ganzen Gebiet, nach Nordosten seltener.    ...cyanescens (Ratz., 1837) ...cyanescens (Ratz., 1837)
(=coeruleus Rossi)
|
|
|
-- |
Stirn höchstens mit ganz flacher Längsfurche. Halsschild neben den Hinterwinkeln mit einem Kielchen, das nur selten undeutlich ist. Halsschildseitenrand nicht grubig vertieft (andernfalls vergleiche betuleti Leitzahl >>>34) Kinnfortsatz nur leicht ausgerandet. Ober- und Unterseite gleichfarbig. ...20
|
|
|
#20 |
Kinnfortsatz der Vorderbrust gerundet oder nur flach ausgerandet [Abb.67]. Oberseite meist leuchtend blau, aber auch grün bis olivgrün [Abb.68]. Größere Art: 6-8,5 mm.
♂: Fühler gestreckt; 2. Sternit am Hinterrand mit 2 Höckerchen. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus asymmetrisch erweitert [Abb.69] [Abb.70].
♀: Stirnfeld länger als breit, Augen am Scheitel mehr genähert als bei angustulus [Abb.71]. ♀ mit ausnahmsweise einfachem 5. Sternit sind von viridis durch den fehlenden Quereindruck des Halsschilds zu unterscheiden.
B: Larve in der Rinde von Eichen. V-VIII.
D: Im ganzen Gebiet häufig.     ...sulcicollis Lacord., 1835 ...sulcicollis Lacord., 1835
|
|
|
-- |
Kinnfortsatz der Vorderbrust tief, etwas V-förmig ausgerandet [Abb.72]. Kleinere Arten bis 6,5 mm; weniger lebhaft gefärbt. ...21
|
|
|
#21 |
Mittelgroße Art: 4-6,5 mm [Abb.73]. Stirn über den Augen flacher gewölbt [Abb.74]. Olivgrün bis bronzefarben oder dunkelblau.
♂: Hinterrand des 2. Sternits mit 2 Höckerchen [Abb.75]. Die letzten Fühlerglieder gestielt,die Fortsätze an der Spitze breit verrundet [Abb.76]. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.77] [Abb.78].
♀: Stirnfeld quadratisch, Augen auf dem Scheitel einander kaum näherstehend als auf der Stirn [Abb.79].
B: Larve vorwiegend in Eiche, aber auch in Buche, Hainbuche und Hasel. V-VIII.
D: Im ganzen Gebiet die häufigste Art der Gattung.     ...angustulus (Ill., 1803) ...angustulus (Ill., 1803)
|
|
|
-- |
Kleinste Art der Gruppe: 3,5-5 mm. Etwas dunkler als angustulus gefärbt [Abb.80]. Stirn mit den Augen in einer Flucht gewölbt [Abb.81]. Prosternalfortsatz zwischen den Vorderhüften manchmal etwas rautenförmig (=asperrimus auct.?).
♂: 2. Sternit einfach, letzte Fühlerglieder 3-eckig [Abb.82]. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.83] [Abb.84].
♀: Von kleinen Exemplaren. des angustulus am sichersten durch die gewölbte Stirn zu unterscheiden.
B: Larve in Eiche, Hainbuche, Linde. VI-VII.
D: Im Süden und Mitte des Gebietes; selten.     ...obscuricollis Kiesw., 1857 ...obscuricollis Kiesw., 1857
|
|
|
#22 |
Halsschild ohne Kiele neben den Hinterwinkeln [Abb.85], selten mit Spuren davon. Hinterleib ohne helle, fleckige Behaarung. ...23
|
|
|
-- |
Von den Hinterwinkeln des Halsschilds entspringt ein Kiel der ± weit nach vorne verlängert ist und manchmal die Vorderwinkel erreicht [Abb.86]. Bei Arten mit fleckig hell behaartem Hinterleib kann dieser Kiel mitunter sehr undeutlich sein. ...26
|
|
|
#23 |
Halsschild hochgewölbt, zu den Seitenrändern überall steil abfallend [Abb.87]. Stirn flach gefurcht, stark vorgewölbt. Kinnfortsatz nicht ausgerandet. Kleiner, 3,5-6 mm. Kupfrig-violett [Abb.88];
♂: Klauentyp E [Abb.39]. Aedoeagus [Abb.89] [Abb.90].
B: Entwicklung in Hypericum perforatum und Hypericum tetraterum. VI-VIII.
D: Südeuropa, südliches Mitteleuropa; stellenweise und selten.     ...hyperici (Creutz., 1799) ...hyperici (Creutz., 1799)
Kinnfortsatz ausgerandet: vergleiche auch convexifrons, LZ >>>48
|
|
|
-- |
Halsschildseiten in den hinteren Bereichen verflacht [Abb.91]. ...24
|
|
|
#24 |
Scheitel mit deutlicher Mittelfurche [Abb.91] [Abb.92], Augen kleiner, bei Ansicht von oben etwa 1/4 der Stirnbreite [Abb.93]. Größer, 5-7 mm. Dunkel bronzefarben [Abb.94], selten grünlich, Halsschild nicht auffallend hochgewölbt. Flügeldecken unauffällig dunkel behaart.
♂: Klauentyp C [Abb.23]. Aedoeagus [Abb.95].
B: Entwicklung in Seidelbast (Daphne mezereum und andere Arten der Gattung Daphne). V-VII.
D: Im Süden und Osten des Gebietes, nicht häufig.     ...integerrimus (Ratz., 1839) ...integerrimus (Ratz., 1839)
|
|
|
-- |
Scheitel höchstens ganz flach gefurcht, Augen größer, bei Ansicht von oben mindestens 1/3 der Stirnbreite [Abb.96]. ...25
|
|
|
#25 |
Fühler blattartig verbreitert (ähnlich wie bei laticornis ♂, nur etwas schwächer), sehr kurz gestielt, die Fühlerglieder ab dem 5. auffallend breit abgerundet. Flügeldecken vor dem Apex seitlich nicht ausgerandet, gleichmäßig verjüngt. Zweifarbig: Halsschild golden bis bronzefarben, Flügeldecken und Kopf dunkel olivgrün [Abb.97], manchmal blau [Abb.98]; die Färbung bei Tieren aus dem Süden kontrastreicher. Stirn und Scheitel ungefurcht. Flügeldeckenspitze oft mit einigen helleren Haaren besetzt.
♂: Klauentyp B [Abb.28]. Der Aedeagus sehr schlank und parallel, zum Apex nicht erweitert [Abb.99].
♀: Der Ovipositor schlank, gestreckt. 6-8 mm.
B: Larve in Ulmen; bei Tieren von Linden vergleiche folgende Art.
D: Südeuropa, südöstliches. Mitteleuropa, nach Nordwesten bis Hessen;     ...auricollis Kiesw., 1857 ...auricollis Kiesw., 1857
|
|
|
-- |
Die Fühlerglieder zierlich, lang gestielt, insbesondere die Glieder 5-7 scharf zugespitzt, auch die folgenden nur schwach abgestumpft [Abb.100]. Größe der Typen 6,8-8,2 mm. Die Geschlechter sind nach der Beschreibung unterschiedlich, einfarbig gefärbt [Abb.101]: ♂ grün-golden, ♀kobaltblau. Die Flügeldecken vor dem Apex leicht ausgerandet.
♂: Der Aedeagus im vorderen Bereich löffelartig erweitert [Abb.102].
♀: Ovipositor sehr kurz und breit [Abb.103].
B: Brutpflanze scheint wohl Linde zu sein; ältere Meldungen für auricollis von Linde beziehen sich vermutlich auf diese Form.
D: Aus Frankreich beschrieben, vermutlich weit verbreitet, aber nicht erkannt.   ...rosei Niehuis & Bernhard, 2005 ...rosei Niehuis & Bernhard, 2005
Jendek (2016, l.c.) betrachtet rosei als Synonym von viridis (Form ohne Halsschildkielchen). Wenn es sich aber herausstellt, daß diese Form regelmäßig an Linde gefunden wird, ist der Status zu überprüfen.
|
|
|
#26 |
Kinnfortsatz der Vorderbrust groß, tief winkelig ausgeschnitten. 2 große Arten, meist über 7 mm; Oberseite kahl bzw. dunkel behaart. ...27
|
|
|
-- |
Kinnfortsatz weniger stark entwickelt, in der Mitte nur flach ausgerandet; kleinere Arten, selten über 7 mm; zum Teil hell behaart. ...28
|
|
|
#27 |
Halsschildseitenrandkanten zu den Hinterwinkeln schwach konvergierend, nicht in der Mitte plötzlich vereinigt [Abb.104]. Fühler gedrungener, 2. und 3. Glied kaum doppelt so lang wie breit. Flügeldeckenseitenrand im letzten Drittel nur schwach konkav. Oberseite unauffällig, dunkel behaart, Flügeldecken hinten neben der Naht oft mit einem heller behaarten Längsstreif. Unterseite und Pleurite einförmig hell behaart. Unterseite schwarz-dunkelbronzen mit violettem Schimmer, Oberseite kupfrig-violett [Abb.105], mitunter ähnlich wie der nachfolgende gefärbt, dann aber durch den Fühlerbau gut zu unterscheiden. 4,5-10 mm.
♂: 5. Sternit mit Mittelkiel. Klauentyp A [Abb.6]. Aedoeagus [Abb.106] [Abb.107].
B: Larve in Baum-Rosaceen, auch in Obstbäumen, denen er schädlich werden kann (,,Birnenprachtkäfer"). V-VII.
D: Vor allem im Südwesten, nicht selten; nach Norden und Osten selten oder fehlend.    ...sinuatus (Ol., 1790) ...sinuatus (Ol., 1790)
|
|
|
-- |
Halsschildseitenrandkanten von der Mitte an vereinigt, Fühler sehr gestreckt, 2. und 3. Glied reichlich doppelt so lang wie breit. Flügeldecken lang geschwänzt, Oberseite lang. ± dunkel behaart, Unterseite und Pleurite hell behaart. Unterseite grün, Kopf und Halsschild goldgrün, Stirn blau, Flügeldecken kupfrig. 7,5-12 mm.
♂: 5. Sternit gekielt. Klauentyp E [Abb.39]. Aedoeagus [Abb.108].
B: Entwicklung in Ebereschen, möglicherweise auch in anderen Baum-Rosaceen.
D: Nordeuropa, Nordosteuropa, Baltikum; aus Mitteleuropa (Ostpreußen; Schlesien?, Böhmen?) nur alte Meldungen.    ...mendax Mannh. ...mendax Mannh.
|
|
|
#28 |
Augen klein, von vorne betrachtet liegt die Fühlereinlenkung unterhalb einer gedachten Verbindungslinie der unteren Augenränder [Abb.109]. Wangen groß, etwa so breit wie der Querdurchmesser der Augen [Abb.110]. ...29
|
|
|
-- |
Augen größer, die Fühlereinlenkung liegt oberhalb der Verbindungslinie der unteren Augenränder [Abb.111]. Wangen schmal, halb so breit wie der Querdurchmesser der Augen [Abb.112]. ...30
|
|
|
#29 |
Größere Art: 8-9 mm [Abb.113]. 3. bis 5. Sternit an den Seiten dichter hell behaart als auf der übrigen Unterseite [Abb.114]; die ziemlich langen Haare bilden deutliche Flecken, die bei frischen Tieren weiß bestäubt sind. Oberseite ebenfalls mit hellen, aber wenig auffallenden Haaren besetzt. Meist goldgrün bis blaugrün, braunkupfrig, selten purpurn.
♂: Stirn und Wangen lang hell behaart; Klauentyp D [Abb.115]. Aedoeagus [Abb.116].
B: Entwicklung in Weiden.
D: Ost- und Südwesteuropa; in neuerer Zeit bis Kärnten nachgewiesen; selten.    ...lineola Redt. ...lineola Redt.
|
|
|
-- |
Kleinere Art: 4,5-6,5 mm [Abb.117]. 3. bis 5. Sternit gleichmäßig dünn und kurz behaart wie die übrige Unterseite. Dunkel olivgrün bis bronzefarben.
♂: Stirn und Wangen dicht hell behaart; Klauentyp C [Abb.23]. Aedoeagus [Abb.118].
B: Entwicklung in Strauchweiden.
D: Sicher weit verbreitet, aber wenig gemeldet. Viele Meldungen von cuprescens LZ >>>37) sind wohl auf diese Art zu beziehen.     ...salicis Friv., 1877 ...salicis Friv., 1877
(=acutangulus Théry )
|
|
|
#30 |
Oberseite weitgehend unbehaart oder nur mit unauffälligen dunklen Haaren besetzt, kahl erscheinend; manchmal (viridis-Gruppe) ist ein feiner Streif heller Haare neben der Naht vorhanden. Im Zweifelsfall der Prosternalfortsatz bei seitlicher Betrachtung zur Spitze sanft abfallend [Abb.119] oder fast in einer Ebene. ...31
|
|
|
-- |
Oberseite mit hellen Haaren ± dicht besetzt, die Behaarung mitunter fleckig oder in Streifen. Die Betrachtung muß im streifenden Licht erfolgen. Im Zweifelsfall Prosternalfortsatz bei seitlicher Betrachtung zu Spitze steil abfallend, mit Knick [Abb.120]. ...40
|
|
|
#31 |
Halsschild jederseits neben dem Seitenrand zwischen der Mitte und dem Hinterwinkel auffallend tief eingedrückt. Die Punkte auf dem Scheitel rund oder in die Länge gezogen, aber nicht längsrunzelig verflossen. ♂: Klauentyp F [Abb.121] oder C [Abb.23]. ...32
|
|
|
-- |
Halsschild am Seitenrand in der Mitte nur leicht eingedrückt. Punktur auf dem Scheitel längsrunzelig verflossen. ♂: Klauentyp B [Abb.28] oder E [Abb.39]. ...35
|
|
|
#32 |
Einfarbig hell- oder dunkelblau, mitunter leicht 2-farbig. Scheitel undeutlich gefurcht (Unterschied zu cyanescens !). ...33
|
|
|
-- |
Flügeldecken dunkel gefärbt, mit schwachem grünen oder Erzschein, Halsschild gleichfarbig oder abstechend anders. ...34
|
|
|
#33 |
Innenränder Augen +/- parallel oder nach oben leicht bogig divergierend. Scheitel hoch aufgewölbt, mit länglichen Punkten. Der vordere Eindruck in der Halsschildmitte vorhanden [Abb.122]. ♂ und ♀: Klauen mit kurzen, schlanken, gebogenen Zähnchen an der Innenseite (Klauentyp F [Abb.121]). 5,6-7,8 mm.
♂: Aedoeagus [Abb.123].
B: Entwicklung in Zitterpappel, Weiden?.
D: Typus aus Österreich; Rußland, Polen, Schweiz. Stets sehr selten.    ...pseudocyaneus Kiesw., 1857 ...pseudocyaneus Kiesw., 1857
|
|
|
-- |
Innenränder der Augen nach oben gerade divergierend. Scheitel normal gewölbt, kaum punktiert, die Punkte rund. Der vordere Eindruck in der Halsschildmitte erloschen oder fehlend [Abb.124]. Beide Geschlechter Klauentyp F [Abb.121]. 4-5,3 mm. Früher als ssp.von pseudocyaneus betrachtet, nach Jendek (l.c.) aber selbstständige Art.
B: Entwicklung in Salix viminalis, Salix caprea.
D: Süd- und Osteuropa; nördlich bis Finnland, westlich bis Frankreich; daran schließen die Meldungen aus der Pfalz an.    ...delphinensis Abeille, 1897 ...delphinensis Abeille, 1897
|
|
|
#34 |
Bunte Art: Flügeldecken blau-schwarz bis schwarz, Halsschild golden-kupfrig-purpurn [Abb.125]. Scheitel sehr hoch gewölbt. Augen vorragend. ♂ und ♀: Klauentyp F [Abb.121]. 4-8 mm.
♂: Aedoeagus [Abb.126].
B: Entwicklung vor allem in Zitterpappel, aber auch in anderen Pappel- und eventuell auch Weidenarten. V-VIII.
D: Weit verbreitet, aber nach Norden selten; im Nordosten wohl fehlend.     ...pratensis (Ratz., 1839) ...pratensis (Ratz., 1839)
(=roberti Chevr.)
|
|
|
-- |
Einfarbig, schwarz mit grünem Schein [Abb.127]; Scheitel einfach, schwach gewölbt. Augen aus der Kontur des Kopfes nicht vorragend. 4-6 mm.
♂: Klauentyp C [Abb.23]. Aedoeagus [Abb.128] [Abb.129].
B: Entwicklung in Birken. V-VIII.
D: Überall, nicht häufig.     ...betuleti (Ratz., 1837) ...betuleti (Ratz., 1837)
|
|
|
#35 |
Relativ große Art: 7-11 mm; blau, grün, gold oder bronzen [Abb.130]. Äußere Hinterkante der, Mittel- und Hinterschenkel mit ziemlich großen, spitzen Zähnchen besetzt [Abb.131]. Tarsen breit, 4. Hintertarsenglied viel breiter als die gespreizten Klauen; 3. Glied wenig schmäler als das 4. und viel breiter als das 2. [Abb.132]. Flügeldecken kaum behaart. 6.-10. Fühlerglied beim ♂ deutlich, beim ♀ viel breiter als lang. Vorderschienen - besonders beim ♂ - gleichmäßig gebogen. Seitenrand der Flügeldecken vor der Spitze ausgeschweift.
♂: Kopf etwas rauh, Brust lang bürstenartig behaart. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.133].
B: Entwicklung in Pappelarten; Weiden?.
D: Verbreitung in Mitteleuropa nur ungenügend bekannt; sicher im Südosten und Südwesten des Gebietes; nach Norden bis in das nordöstliche Niedersachsen und Umgebung Berlin; ebenfalls in Nordeuropa (Schweden).     ...suvorovi Obenb., 1935 ...suvorovi Obenb., 1935
(=populneus Schaef., 1946)
|
|
|
-- |
Im Durchschnitt kleiner: 4,5-9 mm. Schenkel ohne Zähne, oft aber mit flachen Körnchen an der Hinterkante. 4. Hintertarsenglied kaum breiter als die gespreizten Klauen, das 3. wenig breiter als das 2.. Vorderschienen ziemlich gerade. ...36
|
|
|
#36 |
Dunkel bronzefarben bis schwärzlich, Flügeldecken deutlich dunkel behaart. Stirn und Scheitel gefurcht. 6.-10. Fühlerglied viel breiter als lang. Glänzende, parallele Art; Flügeldecken zur Spitze gleichmäßig gerundet. Spitze des Prosternalfortsatzes ± stark zum Körper gebogen. 4,5-7 mm.
♂: Stirn nicht auffällig behaart, Vorderbrust kurz bürstenartig behaart. Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.134].
B: Entwicklung in Rosaceen (Aprikose, Pflaume).
D: Südosteuropa; nordwestlich bis Umgebung Wien.    ...fuscosericeus Daniel ...fuscosericeus Daniel
(=macroderus Ab. sensu Obenb.)
|
|
|
-- |
Flügeldecken fast kahl, eine Behaarung ist nur schwer sichtbar; oft jedoch mit einem feinen Längsstreif hellerer Haare neben der Naht vor der Spitze der Flügeldecken. ...37
|
|
|
#37 |
Die kleinste Art der Gruppe: 4,5-7 mm [Abb.135]. Flügeldecken zur Spitze gleichmäßig gerundet, nicht deutlich ausgeschweift. Fühlerglieder relativ breiter und gedrungener, die Außenecken verrundet. Augenränder auf dem Scheitel weiter voneinander entfernt als unten auf der Stirn vor den Fühlern. Kinnfortsatz schmal, nicht oder nur ganz schwach ausgerandet. Halsschild vor der Mitte am breitesten, zur Basis gerundet verengt, vor den ± verrundeten Hinterwinkeln nicht ausgeschweift. ♀ und ♂ in der Körperform kaum verschieden. Grün, blaugrün bis olivgrün, meist jedoch bronzen.
♂: Aedoeagus [Abb.136] [Abb.137]; Stirn spärlich anliegend, Vorderbrust bürstenartig behaart. Klauentyp B [Abb.28].
B: Entwicklung in Rubus- und Rosa-Arten. Die Larven erzeugen in den befallenen Stengeln typische spindelförmige Gallen mit rauher und rissiger Oberfläche. In Südeuropa Schädling in Rosenkulturen.
D: Südliches Europa; bei uns im Süden des Gebietes nicht häufig, aber aus allen Bundesländern gemeldet. Sonstige Verbreitung ungeklärt, da mit salicis LZ >>>29) vermengt. VI-VIII.    ...cuprescens Menetr., 1832 ...cuprescens Menetr., 1832
(=obtusus sensu Reitter)
(=communis Obenb.)
(=chrysoderes auct.)
(=rubicola Ab.)
(=epistomalis Ab.)
(=aurichalceus Redtb.)
A. salicis (=acutangulus) und cuprescens (=aurichalceus) waren in einigen Sammlungen konfundiert; die Arten sind aber spezifisch verschieden und nach dem Genital einwandfrei zu trennen.
|
|
|
-- |
Größere Arten: 5-10 mm. Flügeldeckenseitenrand vor der Spitze ± deutlich ausgeschweift [Abb.138], besonders beim ♀, oder die Flügeldecken zur Spitze sehr schlank und der Halsschildseitenrand vor dem ± scharfen Hinterwinkeln etwas ausgeschweift. Kinnfortsatz stärker entwickelt, deutlich ausgerandet. ♂: Klauentyp B [Abb.28]. ...38
|
|
|
#38 |
Flügeldecken zur Spitze gleichmäßig verschmälert, Seitenrand vor der Spitze fast gerade [Abb.139]. Halsschild quer, am Vorderrand viel breiter als der Kopf, die Seitenränder vor den Hinterwinkeln etwas ausgeschweift, so daß die Hinterecken deutlich markiert sind. Scheitel etwas stärker gewölbt und tiefer gefurcht als bei viridis f. typ.. Hell bronzefarben bis golden-kupfrig mit violettem Schimmer. Von viridis morphologisch und durch die Lebensweise deutlich getrennt.
♂: Parameren zur Spitze verbreitert [Abb.140] [Abb.141].
B: Entwicklung in Ribes-Arten.
D: Südwesteuropa. Bei uns im Südwesten des Gebietes, einzelne Funde bis Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.     ...ribesi Schaefer, 1946 ...ribesi Schaefer, 1946
|
|
|
-- |
Flügeldeckenseitenrand vor der Spitze meist deutlich ausgeschweift, vor allem beim ♀. Halsschild zur Basis gerade verengt, Hinterwinkel meist nicht durch eine Ausrandung besonders betont (kommt aber gelegentlich vor). 5-10 mm.
♂: Meist einfarbig gold, grün [Abb.142] bis blau, sehr selten wie ♀ gefärbt! Parameren zur Spitze nur wenig verbreitert [Abb.143] [Abb.144].
♀: Meist 2-farbig: Flügeldecken von golden über grün bis blau [Abb.145], Kopf, Halsschild und Unterseite golden, kupfrig, violett [Abb.146]; einfarbige ♀ von der var. fagi wohl kaum zu unterscheiden.
B: Entwicklung in Weiden; Eichen?
D: Im ganzen Gebiet, nach Norden seltener. V-VIII. Stammform.     ...viridis (L., 1758) ...viridis (L., 1758)
(=linearis (Panz.))
Anmerkung: Die Auftrennung der verschiedenen Formen der viridis-Gruppe nach morphologischen Merkmalen allein wird meines Erachtens den biologischen Gegebenheiten nicht gerecht. Offensichtlich ist die "polyphage Art" A. viridis ein Komplex ökologisch getrennter Rassen beziehungsweise Arten.
Folgende weitere Formen, von denen einige durch zahlreiche Übergänge verbunden sind und deren systematischer Rang noch ungenügend geklärt ist, werden für den mitteleuropäischen Raum aufgeführt (siehe Obenberger l. c.); die Formen, die ich für eigene Arten halte sind mit "sp.prop." gekennzeichnet. ...39
|
|
|
#39 |
♂: Parameren zur Spitze etwas verbreitert und mit längerem Borstenfeld [Abb.147] [Abb.148]. Einfarbig bronzen bis golden [Abb.149], selten blaugrün, etwas düsterer gefärbt als viridis f.typ..
♀: Färbung wie beim ♂.
B: Entwicklung in Buche (oft sehr schädlich).
D: Im ganzen Gebiet, nach Süden häufiger. sp.prop.   ...fagi Ratzeb. ...fagi Ratzeb.
|
|
|
= |
Blau bis blauviolett. Stirnfeld zwischen den Augen relativ breiter als bei der Stammform.
B: Gemeldet aus Birke, Erle, Gagelstrauch, Buche, Ahorn, Pappel. sp.prop.  ...nocivus Ratzeb. ...nocivus Ratzeb.
|
|
|
= |
Oberseite chagriniert und daher auffallend matt. Dunkel bronzefarben.
D: Böhmen. var.  ...montanellus Obenb. ...montanellus Obenb.
|
|
|
= |
Oberseite goldfarben bis kupfrig. Flügeldecken entlang der Naht mit weißer Haarbinde (kommt auch bei Stammform vor).
D: Wien, Serbien. var.  ...cernyi Obenb. ...cernyi Obenb.
|
|
|
-- |
Parameren sehr schlank und auch vorne schmal [Abb.150], Medianlobus relativ spitz gerundet [Abb.151]. Flügeldeckenspitze zur Naht hin abgeschrägt [Abb.152] [Abb.153] [Abb.154]. Vergleiche ribesi LZ >>>38
|
|
|
#40 |
Flügeldecken neben der Naht der ganzen Länge nach eingedrückt und dort viel dichter hell behaart als auf der übrigen Oberseite [Abb.155] (bei streifendem Licht betrachten). ...41
|
|
|
-- |
Flügeldecken neben der Naht ohne auffallenden Längseindruck, aber manchmal mit einem etwas dichter behaarten Streifen. ...42
|
|
|
#41 |
Stirn flach, kaum gefurcht. Punkte auf dem gewölbten Scheitel in grobe Längsrunzeln verflossen. Halsschild an den Seiten gleichmäßig gerundet, etwa in der Mitte am breitesten [Abb.156]. Flügeldecken schlank, Außenrand vor der Spitze etwas ausgerandet. Bronzefarben, 5,5-10 mm.
♂: Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.157] [Abb.158].
B: Entwicklung in verschiedenen Ginsterarten. VII-VIII.
D: Im Südwesten und Südosten; selten.     ...cinctus (Ol., 1790) ...cinctus (Ol., 1790)
|
|
|
-- |
Stirn mit flacher aber deutlicher Furche, Scheitel flach, die Punkte zu viel feineren Längsrunzeln verflossen. Halsschild vor der Mitte am breitesten, von der Mitte zur Basis etwas konkav, Halsschildoberseite an den Seiten lang behaart. Flügeldecken breiter, von der Mitte zur Spitze +/- gerade verengt. Der Eindruck neben der Naht ziemlich flach, weniger abstechend hell behaart. Kupfrig-bronzefarben. 5-8 mm.
♂: Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.159].
B: Entwicklung in verschiedenen Ginsterarten. Vll.
D: Südeuropa; neuerdings aus Hessen gemeldet.   ...antiquus Muls., 1863 ...antiquus Muls., 1863
|
|
|
#42 |
Pleurite mit langen Haaren dicht besetzt, so daß der Untergrund fast bedeckt ist. Scheitel gewölbt und gefurcht. Kiele neben den Halsschildseitenrand von den Hinterwinkel bis zu den Vorderwinkel reichend. ♂: Klauentyp G [Abb.160]. Kinnfortsatz ausgerandet. ...47
|
|
|
-- |
Pleurite ohne auffallende Behaarung, Klauen anders, Kielchen der Halsschildhinterwinkel meist kürzer. ...43
|
|
|
#43 |
4. Fühlerglied höchstens so lang wie breit, 5. und die folgenden stark quer, viel breiter als lang (Fühler kurz). ...44
|
|
|
-- |
4. Fühlerglied viel länger als breit, auch das 5. nicht breiter als lang (Fühler gestreckt). ...48
|
|
|
#44 |
Kopf, Halsschild und Flügeldecken rötlich kupfern bis violett [Abb.161], Unterseite bronzefarben oder gleichfarbig. Halsschild vor den Hinterwinkel kaum ausgeschweift, Querkiel des Schildchens etwas nach vorn gebogen. Klauen beim ♂ und ♀ ähnlich Typ C [Abb.23], jedoch der Basalzahn viel schlanker. 4,2-7 mm.
♂: Aedoeagus [Abb.162] [Abb.163].
B: Entwicklung in Rubus-Arten und Rosen.
D: Südwesteuropa.    ...solieri Gory & Laporte, 1837 ...solieri Gory & Laporte, 1837
|
|
|
-- |
Flügeldecken dunkel, bronzen oder golden, Halsschild zur Basis stark verengt. ♂: Klauentyp B [Abb.28]. ...45
|
|
|
#45 |
Seitenrand vor den Hinterwinkel deutlich ausgeschweift, Hinterecken dadurch vorstehend. Querkiel des Schildchens gerade, sonst der vorigen Art sehr ähnlich. 3,5-6,5 mm.
♂: Klauentyp B [Abb.28]. Aedoeagus [Abb.164].
B: Entwicklung in verschiedenen Arten von Ericaceen und Cistaceen.
D: Westliches Mittelmeergebiet.   ...elegans Mulsant & Rey, 1863 ...elegans Mulsant & Rey, 1863
|
|
|
-- |
Halsschild nur schwach verengt, Seitenrand kaum ausgeschweift, Halsschildhinterecken nicht vorstehend. 5-7 mm. 2 Arten, die nach äußeren Merkmalen wohl nicht sicher unterschieden werden können. (Nach Thery l. c. beide synonym zu antiquus). ...46
|
|
|
#46 |
Ein wenig gedrungener [Abb.165].
♂: Aedoeagus [Abb.166] [Abb.167]. Behaarung der Flügeldecken ganz gleichmäßig. Fühler sehr kurz, seitlich die Halsschildmitte lange nicht erreichend.
B: Soll sich in Genista-Arten entwickeln.
D: Im Südosten des Gebietes; Umg. Wien. .     ...curtii Obenb. ...curtii Obenb.
(=hucul Obenb. (♀))
|
|
|
-- |
Etwas gestreckter, Flügeldecken an der Spitze etwas schlanker [Abb.168]; Behaarung neben der Flügeldeckennaht oft ein wenig dichter als neben dem Seitenrand. Fühler länger, seitlich die Halsschildmitte fast erreichend.
♂: Aedoeagus [Abb.169] [Abb.170].
D: Südosteuropa bis Steiermark und Burgenland.     ...croaticus Ab. ...croaticus Ab.
|
|
|
#47 |
Größere Art: 7-8 mm [Abb.171]. Stirn mit ziemlich tiefer Längsfurche. Fühler gestreckt, Glieder 5-11 nur wenig breiter als lang. Abstand des Kielchens neben den Halsschildhinterwinkel vom Seitenrand etwa gleich dem der beiden Halsschildseitenrandungen vorn hinter den Vorderrand. Oberseite wenig auffallend, locker hell behaart. Sternite kurz und spärlich behaart (Stammform) oder mit unscharfen Haarflecken (ssp. artemisiae Brisout). Goldgrün bis blaugrün, die Stammform selten bronzen, meist dagegen ssp. artemisiae.
♂: Klauentyp G [Abb.160]. Aedoeagus [Abb.172]. [Abb.173].
B: Entwicklung in Artemisia campestris. Im Gebiet nur aus dem Südosten; sonst Südeuropa.    ...albogularis Gory ...albogularis Gory
|
|
|
-- |
Kleinere Art: 5-6 mm. Stirn meist etwas flacher gefurcht. Fühler gedrungener, Glieder 5-11 deutlich breiter als lang. Die beiden Halsschildseitenrandungen vorne sehr breit getrennt; ihr Abstand etwa doppelt so breit wie der des Halsschildskielchens an der Basis vom Seitenrand; Flügeldecken dichter und länger behaart als bei dem vorigen. Sternite mit unbestimmten Flecken langer heller Behaarung (wie auf den Pleuriten, aber weniger dicht). Grün bis goldgrün
♂: Klauentyp G [Abb.160]. Aedoeagus [Abb.174]..
B: Biologie unbekannt.
D: Südosteuropa; vielleicht im äußersten Südosten Mitteleuropas.    ...sericans Kiesw. ...sericans Kiesw.
|
|
|
#48 |
Kinnfortsatz ziemlich tief und breit ausgerandet, Stirn gewölbt, wenig tief punktiert und ganz flach gefurcht. Halsschild zur Basis leicht ausgeschweift verengt, dort viel schmäler als vor der Mitte, ohne Längsfurche aber mit 2 Quereindrücken. Kiele vor den Hinterwinkeln fast erloschen, nur angedeutet, aber bis zu den Vorderecken reichend. Dunkel bronzefarben mit kupferfarbiger Stirn. 5,5 mm.
♀: (!): Klauentyp C [Abb.23].
B: Biologie unbekannt.
D: Aus Österreich beschrieben; Südrußland; sehr selten.    ...convexifrons Kiesw., 1857 ...convexifrons Kiesw., 1857
Alle so bezeichneten Tiere, die ich gesehen habe, gehörten zu anderen Arten; nomen dubium?
|
|
|
-- |
Kinnfortsatz abgerundet oder nur sehr flach und schmal ausgerandet [Abb.175]. Bei dem hier folgenden roscidus-Komplex sind mit Sicherheit oft nur die ♂ nach morphologischen Merkmalen bestimmbar, die ♀ meist nur nach der Entwicklungs- oder Fraßpflanze. Der Komplex bedarf dringend einer Revision. ...49
|
|
|
#49 |
Behaarung der Flügeldecken fein und weniger auffällig [Abb.176]. Prosternalfortsatz bei Seitenansicht in scharfem Knick zur Spitze abfallend, die abgesetzte Spitze etwa 1/3 so dick wie der Prosternalfortsatz [Abb.177], in Aufsicht zur Spitze schmal zugespitzt verengt [Abb.178]. Meist 2-farbig gefärbt: Halsschild und Kopf grün (♂ [Abb.179]) oder kupferig (♀ [Abb.180]), Flügeldecken +/- grünlich bronzefarben. 4,5-8 mm.
♂: Vorderbrust lang bürstenartig behaart. Klauentyp E [Abb.39]. Das 1. Glied der Hintertarsen der Länge nach unterseits mit langen, abstehenden Haaren [Abb.181]. Mittelschienen an der Spitze innen mit einem deutlich sichtbaren Zähnchen [Abb.182]. Aedoeagus größer und schlanker [Abb.183].
B: Entwicklung in Misteln (Viscum album).
D: Südeuropa, nach Norden bis Österreich, Tschechien, Slowakei, Deutschland.     ...graecus Obenberger, 1916 ...graecus Obenberger, 1916
(=viscivorus Bilý, 1991)
|
|
|
-- |
Behaarung der Flügeldecken auffälliger, heller und etwas breiter [Abb.184]. Die Spitze des Prosternalfortsatzes weniger stark abgesetzt, seitlich betrachtet etwa halb so dick wie der Prosternalfortsatz [Abb.120] [Abb.185], in Aufsicht breiter, parallel, gerundet zugespitzt [Abb.186] [Abb.187]. Bei uns einfarbig oder kaum mehrfarbig. Kleiner: 3,5-6,5 mm.
♂: Mittelschienen an der Spitze nur mit einem winzigen, in der dunklen Beborstung kaum sichtbaren Zähnchen [Abb.188]. Das 1. Glied der Hintertarsen höchstens an der Basis mit langen, hellen Haaren. ...50
|
|
|
#50 |
Prosternalfortsatz schmaler [Abb.186], nach hinten etwas verengt.. Stirn fein punktiert und undeutlich mikroretikuliert, glänzend. 4,5-6 mm.
♂: Prosternalfortsatz ohne längere Haare. Mittlere Fühlerglieder spitz dreieckig [Abb.189]. 1. Glied der Hintertarsen ohne lange, helle Haare. Aedoeagus schlank und parallel [Abb.190].
B: Entwicklung in Pistacia sp.
D: Südeuropa: Italien, Greiechenland.   ...marozzinii Gobbi, 1974 ...marozzinii Gobbi, 1974
|
|
|
-- |
Prosternalfortsatz breiter [Abb.187], fast parallel, nach hinten kaum verengt. Stirn gröber punktiert und mit feiner Mikroskulptur, die ihr einen seidigen Glanz verleiht.
♂: Prosternalfortsatz dicht und lang behaart. Mittlere Fühlerglieder gerundet dreieckig [Abb.191]. 1. Glied der Hintertarsen unterseits lang hell behaart. Aedoeagus apikal breiter. ...51
|
|
|
#51 |
Der Kiel in den Halsschildhinterecken kürzer und stärker gebogen [Abb.192], zumeist im hinteren Drittel erlöschend, es kommen aber auch Tiere mit bis zu den Vorderecken durchgehendem Kiel vor. Halschildseiten vor den Hinterecken etwas stärker eingezogen [Abb.193]. Flügeldecken an den Seiten im letzten Drittel nach hinten gerade verengt. Halsschild und Flügeldecken ziemlich gleichfarbig, grün bis goldgrün [Abb.194], seltener bronzefarbig [Abb.195]. 3,5-5,5 mm.
♀: Stirn kupfrig-violett [Abb.196].
♂: Stirn grün [Abb.197]. Seitenrand der Augen auf der Stirn fast regelmäßig konkav (bei roscidus Innenrand der Augen im vorderen Drittel genähert). Klauentyp E [Abb.39]. In der Mitte der Naht zwischen dem 1. und 2. Sternit mit einer vage erhabenen Kante. Mittelschienen mit einem winzigen, in der dunklen Beborstung kaum sichtbaren Zähnchen. Aedoeagus [Abb.198]; die Parameren vor allem an der Unterseite in der Spitzenregion dicht längsrunzelig, matt [Abb.199] [Abb.200] [Abb.201].
B: Entwicklung ausschließlich in Rubus-Arten.
D: Südost- und Südwesteuropa, In Deutschland am Mittelrhein in Rheinland-Pfalz und Hessen.     ...viridicaerulans rubi Schaefer, 1937 ...viridicaerulans rubi Schaefer, 1937
Die Nominatrasse ist dem rubi sehr ähnlich. Sie unterscheidet sich von ihr nur durch die weniger konkaven, nach hinten konvergierenden Innenränder der Augen, die Färbung ist ein schön glänzendes Blaugrün, manchmal Violett und bei den ♂ durch die deutlichere Auszeichnung an der Naht der Sternite 1 und 2; die anderen sekundären Geschlechtsmerkmale, die Genitalbewehrung und die Genitalien sind ähnlich.
D: Levante.    ...viridicaerulans Marseul, 1868 ...viridicaerulans Marseul, 1868
|
|
|
-- |
Kiele der Halsschildhinterwinkel länger und flacher gebogen [Abb.202], fast parallel zu Seitenrand; selten kurz hinter der Mitte verlöschend, meist bis zu den Vorderecken verlängert. Halsschildseiten hinten mehr gerade. Flügeldecken im letzten Drittel mehr konkav verengt. Kupfrig-bronzefarben-goldgrün. (der folgene Schlüssel nach Bilý (l.c.)) ...52
|
|
|
#52 |
Gedrungenere Art. Kopf stärker gewölbt. Vorderecken des Halsschilds mit einem glatten Kiel, der parallel zum Seitenrand verläuft und fast die Mitte erreicht. (Vorsicht! Ein solcher Kiel ist auch häufig bei roscidus und viridicaerulans rubi ausgebildet!). Halsschildseitenrand deutlich eingebuchtet vor den Hinterwinkeln (Kommt ebenfalls bei den Vergleichsarten vor!). Oberseite rauher und matter. Bronze-rot bis bronze-violett. 4,9-6 mm.
♀: Stirn gleichfarbig.
♂: Stirn und Scheitel grün. Aedoeagus ähnlich dem des roscidus, aber gedrungener mit stärker gerundeten Parameren. Seine Oberflächenstruktur ist nicht beschrieben.
B: Wirtspflanze ist die Eichen-Mistel (Loranthus europaeus), die in Deutschland nur in einem Wald bei Pirna vorkommt.
D: Tschechien (Typen), Österreich. Südeuropa?   ...kubani Bilý, 1991 ...kubani Bilý, 1991
Wohl nur durch Zucht zu erkennen. Ich kenne die Art nicht.
|
|
|
-- |
Schlankere Art. [Abb.203] [Abb.204]. 4-6,5 mm.
♀: Stirn nicht farblich abgesetzt. Seitenrand des Halsschilds nicht oder undeutlich eingebuchtet. Glänznder, bronze bis bronze-grün.
♂: Stirn grün oder blau. An der Naht zwischen dem 1. und 2. Sternit mit 2 genäherten sehr kleinen Erhabenheiten, die eine Spur deutlicher sind als bei viridicaerulans. Klauentyp E [Abb.39]. Aedoeagus [Abb.205]; die Parameren an der Unterseite in der Spitzenregion spiegelglatt mit zerstreuten länglichen Punkten [Abb.206] [Abb.207].
B: Entwicklung in Baum-Rosaceen, nie in Rubus.
D: Südeuropa; in Mitteleuropa aus Kärnten und dem Burgenland bekannt; neuerdings auch am Oberrhein.     ...roscidus Kiesw., 1857 ...roscidus Kiesw., 1857
Die angegebenen äußeren morphologischen Merkmale sind so variabel, daß die Unterscheidung einzelner ♀ bisher nicht möglich ist. Der in verschiedenen Arbeiten gezeichnete Größenunterschied des Aedoeagus ist nicht vorhanden. Die Struktur der Oberfläche, vor allem an der Unterseite, scheint zur Trennung von viridicaerulans rubi und roscidus aber ein sicheres Merkmal zu sein.
|
|
|
|
albogularis
angustulus
antiquus
anxius
ater
auricollis
auroguttatus
betuleti
biguttatus
cernyi
cinctus
convexicollis
convexifrons
croaticus
cuprescens
curtii
curtulus
cyanescens
delphinensis
derasofasciatus
elegans
fagi
fuscosericeus
graecus
graminis
guerini
hastulifer
hyperici
|
integerrimus
kubani
laticornis
lineola
litura
marozzinii
mendax
montanellus
nocivus
obscuricollis
olivicolor
planipennis
pratensis
pseudocyaneus
ribesi
roscidus
rosei
rubi (viridicaerulans)
salicis
sericans
sinuatus
solieri
subauratus
sulcicollis
suvorovi
viridicaerulans
viridis
ziegleri
|
|
|
Lompe, A. (1979): Agrilus in: Käfer Mitteleuropas, Hrsg. Freude, Harde, Lohse, 6:230-244, Goecke & Evers, Krefeld, Private Datei
Bilý, S. (1991): Two new species of Agrilus roscidus species-group from central Europe (Coleoptera, Buprestidae) - Acta EntomoL Bohemoslov.,88; 371-375 Private Datei
Jendek, E. (1995): Taxonomical notes on the Agrilus betuleti species group with description of two new species - Koleopterologische Rundschau, 65:171-178 Private Datei
Niehuis, M. (1999): Agrilus viridicaerulans rubi Schaefer, 1937, neu für Hessen, mit einigen kritischen Anmerkungen zur Diagnose - Mitt. internat, entomol. Ver. Frankfurt a.M. 24(3/4):121-126 Private Datei
Allemand, R. (2005): Agrilus viscivorus Bil\r, espèce nouvelle pour la faune de France (Coleoptera Buprestidae) - L'Entomologiste 61(4):153-157 Private Datei
Niehuis, M. & Bernhard, D. (2005): Agrilus rosei n. sp. - ein neuer Prachtkäfer aus Frankreich. - Mitt.internat.entomol.Ver. 30(1/2):1-8, 2 Tafeln Private Datei
|
Niehuis, M. (2006): Agrilus (Quercuagrilus) ziegleri n. sp. - ein neuer Prachtkäfer aus Bulgarien. - Mitt.internat.entomol.Ver. 31(1/2):23-29, 2 Tafeln Private Datei
Parsons, G.L. (2008): Emerald Ash Borer. A guide to identification and comparison to similar species - Department of Entomology, Michigan State University agr.illinois.gov
Jendek, E. (2015): Revision of Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832) and related species (Coleoptera: Buprestidae) - Zootaxa 317
Jendek, E. (2016): Taxonomic, nomenclatural, distributional and biological study of the genus Agrilus (Coleoptera: Buprestidae) - Journal of Insect Biodiversity 4(2): 1-57 Private Datei
EFSA (2019): Pest survey card on Agrilus auroguttatus efsa.onlinelibrary.wiley.com
|
|
|

Erstellt am: 05.08.2009
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024 - 01:29:55
Mit Determin (V4.2.332-15) von: Arved Lompe
Vorherige Version |
|