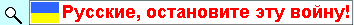| |
Gattung Rhamphus Clairville |
Curculionidae - Rhynchaeninae |
|
|
Von Arved Lompe (n. G.A. Lohse)
Informieren Sie mich bitte über Fehler oder Ergänzungen über mailbox@lompe.de |
Stüben, P & al. (2009): Digital-Weevil-Determination der westpaläartischen Curculionoidea: Isochnus / Orchestes / Pseudorchestes / Rhamphus / Rhynchaenus / Tachyerges (Curculioninae: Rhamphini) - Snudebiller 10, No. 120 www.curci.de |
|
|
Durch die an der Rüsselbasis entspringenden, nicht geknieten Fühler von Rhynchaenus unterschieden. Die 2 Basalglieder der Fühler vergrößert; Augen auf dem Kopf zusammenstoßend; Klauen ungezähnt. Schwarze Arten von 1,2-2 mm. Die Käfer entwickeln sich in Blattminen, in denen sich auch die Larve verpuppt. Auf Gesträuch. |
|
|
#1 |
Basalglied der Fühler hell gelb wie die folgenden Geißelglieder. Halsschild wenig hinter der Mitte am breitesten, seine Seiten kräftig gerundet und zur Basis stärker verengt. Flügeldecken nach hinten etwas stärker erweitert [Abb.1] und ihr Seitenrand in der Mitte breiter abgesetzt, fast über die ganze Länge der Flügeldecken sichtbar. Basalglied der Fühler gelb, höchstens leicht verdunkelt. Letzte Glieder der Fühlergeißel meistens verdunkelt. Penis [Abb.2] [Abb.3]. 1,4-2 mm. In Europa weit verbreitet; in Mitteleuropa überall häufig; Käfer besonders im V-VI an Birke, Weide, Pappel und Gagelstrauch (Myrica). Die in den Blattminen überwinternden Larven verpuppen sich im Frühjahr.  ...pulicarius (Hbst., 1795) ...pulicarius (Hbst., 1795)
|
|
|
-- |
Basalglied der Fühler schwarz oder deutlich dunkler als die Geißelglieder. |
|
|
#2 |
Oberseite mit Bronzeschimmer, Basalglied der Fühler schwarz, die Geißel hell braunrot. Halsschild zu den Seiten sehr dicht, fast verrunzelt punktiert, matt. 1,3-1,5 mm. Südeuropa sowie in Wärmegebieten des mittleren und südlichen Mitteleuropa; auf Crataegus (Weißdorn). ...subaeneus Ill., 1807 |
|
|
-- |
Schwarz, ohne Metallschimmer, etwas glänzend. Die Geißelglieder gelb. ...3 |
|
|
#3 |
Halsschild doppelt so breit wie lang. Die Halsschildpunktur flach, undeutlich gegen die stark chagrinierten Zwischenräume abgegrenzt. Aedoeagus [Abb.4]. 1,3-1,4 mm. Zentralpyrenäen. ...cerdanicus Tempère, 1982 |
|
|
-- |
Halsschild höchstens 1,5x breiter als lang; Halsschildpunktur gröber, schärfer gegen die schwach chagrinierten Zwischenräume abgrenzt. ...4 |
|
|
#4 |
Aedoeagus in Seitenansicht etwa um 90° gebogen [Abb.5] [Abb.6]. Dem pulicarius äußerst ähnlich; etwas schwächer glänzend, Halsschild näher zur Basis am breitesten und nach hinten schwächer verengt, Flügeldecken weniger erweitert und schmäler abgesetzt. Auch das letzte Fühlergeißelglied hell, aber das 1. Fühlerglied braun bis schwarz. Der schmale Seitenrand der höher gewölbten Flügeldecken ist bei Sicht von oben nur von der Mitte bis zur Spitze zu erkennen. Klauen kürzer und weniger kräftig als bei pulicarius. 1,2-1,6 mm. In Mitteleuropa und den benachbarten Gebieten; bei uns überall zu erwarten aber vielfach nicht berücksichtigt. Durchaus nicht selten an baumartigen Rosaceen (Crataegus, Sorbus, Obstbäume).  ...oxyacanthae (Marsh., 1802) ...oxyacanthae (Marsh., 1802)
|
|
|
-- |
Aedoeagus in Seitenansicht flacher, nur um etwa 110° gebogen [Abb.7]. Wirtspflanzen unbekannt. Sizilien. ...kiesenwetteri Tournier, 1873 |
|
|
|
cerdanicus
kiesenwetteri
oxyacanthae
|
pulicarius
subaeneus
|
|
|

Erstellt am: 14.08.2010
Letzte Aktualisierung: 05.03.2019 - 00:17:22
|
|